| Dissertation |
|
|
Inauguraldisseration zur Erlangung des Doktorgrades der Medizin
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz dem Fachbereich vorgelegt von
Rainer Karl Fontana
55283 Nierstein
Ringstraße 37
Mainz, Oktober 1993
|
|
Dekan : Univ. Prof. Dr. rer. nat. R. Wolf
1. Gutachter : Univ. Prof. Dr. med. G. Richard
2. Gutachter : Univ. Prof. Dr. med. F. Grehn
|
|
|
| 1. Einleitung | .. |
| . | Im Gegensatz
zu den retinalen Gefäßen entzieht sich das choroidale Gefäßnetz
weitgehend der fluoreszenzangiographischen Darstellung. Verschiedene Faktoren
sind hierfür verantwortlich. Das Pigmentepithel wirkt wie ein Filter
und absorbiert einen großen Teil der emittierten Fluoreszenz der Aderhautgefäße.
Auch die gleichzeitige Anfärbung der retinalen Gefäße erschwert
eine Interpretation der tiefer liegenden choroidalen Strukturen. In erster
Linie verhindert aber der rasche Austritt von Fluoreszein aus den fenestrierten
Sinusoiden der Choriokapillaris eine Darstellung der größeren Aderhautgefäße
(Archer et al., 1974). Im Jahre 1968 zeigte Dollery im Tierexperiment, daß die Fluoreszenzangiographie bei künstlich erhöhtem Augeninnendruck eine verbesserte Darstellung der Aderhautgefäße ermöglicht. Der intraokulare Druck wurde durch die Saugnapfokulopression nach Kukán (1931, 1936ab) erhöht. Kurz darauf wurden auch am menschlichen Auge vergleichbare sequenzangiographische Untersuchungen durchgeführt (Blumenthal et al., 1970, 1971; Best et al., 1972). Heute ermöglichen die Videofluoreszenzangiographie mit digitaler Bildverarbeitung und Verbesserungen in der Saugnapfokulopression die Ausarbeitung neuer methodischer Ansätze zur Untersuchung der retinalen und choroidalen Hämodynamik. Da sich die in dieser Arbeit vorgestellte Methodik beider Verfahren bedient, scheint es angebracht, zunächst deren geschichtliche Entwicklung und den heutigen Stand der Forschung aufzuzeigen. |
|
1.1.
Die Entwicklung der Saugnapfokulopression |
Nach Vorarbeiten von Schultén, Wahlfors, Bajardi, Anderson, Henderson
und Pristley-Smith führte im Jahre 1917 Bailliart die Ophthalmodynamometrie
in die Augenheilkunde ein (Bailliart, 1917ab, 1920abc). Er entwickelte dazu
ein sondenartiges Gerät mit einem gefederten konvexen Stempel, mit dem
ein Druck auf die temporale Sklera ausgeübt wird, während gleichzeitig
im aufrechten Bild gespiegelt wird. Durch Kompression des Bulbus gegen die
mediale Orbitawand erhöht man schrittweise den intraokularen Druck.
Die Beobachtung des ersten Auftretens von Pulsationen der Zentralarterie
beziehungsweise deren Sistieren bei weiterer Druckzunahme, erlaubt die Bestimmung
des diastolischen bzw. systolischen Blutdrucks der Zentralarterie.
Der hohe Wert dieser Methodik für die ophthalmologische Diagnostik wurde rasch erkannt. Der Bailliart'sche Dynamometer fand weite Verbreitung. Andere Untersucher modifizerten das Bailliart'schen Dynamometer beziehungsweise entwickelten Dynamometer nach anderen physikalischen Prinzipien ( Bliedung, 1924; Dieter, 1928; Baurmann, 1930; Uyemura et al., 1936 ). Auch das heute noch oft benutzte Ophthalmodynamometer nach Müller basiert auf dem Bailliart'schen Prinzip (Müller et al., 1938). Da die intraokulare Druckerhöhung durch die Kompression des Bulbus zwischen Dynamometerstempel und mediale Orbitawand erzeugt wird, wurde das Funktionsprinzip der oben genannten Ophthalmodynamometer unter dem Begriff " Kompressionsverfahren " zusammengefaßt (Kukán, 1936ab). Der Begriff " Impressionsverfahren " bezieht sich auf die Eindellung des Bulbus durch den Stempel des Dynamometers (Weigelin et al., 1963). In den 30er Jahren stellte der Ungar Franz Kukán eine alternative Methode zur künstlichen Erhöhung des intraokularen Drucks vor (Kukán, 1931, 1936ab). Er verließ die Idee des Impressionsverfahrens und erforschte die Wirkung von Saugtrichtern, welche, angesaugt am Bulbus, ebenfalls den intraokularen Druck steigern. In einer Publikation aus dem Jahre 1936 beschreibt Kukán ausführlich die physikalisch-theoretischen Prinzipien der Saugnapfokulopression, ebenso wie den Aufbau seiner Apparatur zur Erzeugung eines negativen Drucks im Saugtrichter. Sie besteht aus drei Komponenten : einer eingeschliffenen Glasspritze von 50 cm3, einem Membranvakuummeter und einem metallenen Saugtrichter. |
|
Abb. 1
Impressionsverfahren
nach Bailliart (oben) : Der Bulbus wird zwischen dem Dynamometerstempel und
der medialen Orbitawand komprimiert. Gleichzeitig tritt eine Dislokation
nach nasal auf. |
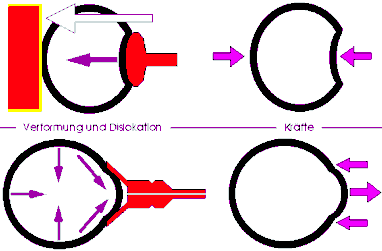
|
| . | Der Saugtrichter
wird temporal auf den Bulbus aufgesetzt, mit der Spritze wird ein negativer
Druck angelegt, welcher am Membranvakuummeter abgelesen werden kann. Da die
Sklera eine flexible, aber nicht dehnbare Struktur ist, werden Skleraanteile
über den Saugnapfrand in den Saugnapf hineingezogen
(Abb. 1)
. Folglich vermindert sich der Umfang des Bulbus, und es kommt zu einer intraokularen
Drucksteigerung. Die Bestimmung des systolischen und diastolische Drucks der
Zentralarterie geschieht analog der Bailliart'schen Ophthalmodynamometrie
(Kukán, 1931, 1936ab). Kukán vergleicht kritisch seine neue Methode mit dem Impressionsverfahren und erörtert eine Reihe von Vorteilen der Saugnapfokulopression. Die Saugnapfokulopression läßt sich leichter erlernen und erfordert vom Untersucher weniger Geschick bei ihrer Durchführung. Bei der Impressionsmethode muß der Untersucher während der gesamten Untersuchung darauf achten, daß die komprimierende Kraft senkrecht zur Bulbusoberfläche einwirkt. Während der Kompression des Bulbus gegen die mediale Orbitawand kommt es zu einer Dislokation des Bulbus nach medial. Dadurch können auf die retrobulbären Gefäße Kräfte einwirken, die deren Durchmesser und somit auch den intraokularen Blutfluß beeinflussen (Abb.1) . Diese Nachteile, die zu Verfälschungen der Meßergebnisse führen können, werden durch die Saugnapfokulopression weitgehend vermieden. Sobald sich der Saugtrichter am Bulbus festgesaugt hat, kann der intraokulare Druck erhöht werden, ohne daß weitere Manipulationen notwendig sind, die zu einer Dislokation des Bulbus führen. Somit läßt sich auch die Funduskopie leichter durchführen (Kukán, 1931, 1936ab). Trotz offensichtlicher Vorteile gegenüber dem Impressionsverfahren fanden die Arbeiten von Kukán zunächst keine Beachtung und das Impressionsverfahren blieb die führende klinische Methode zur Ophthalmodynamometrie. Nach 1960 wurde jedoch die Ophthalmodynamometrie nach dem Kukán'schen Prinzip erneut Gegenstand verschiedener Arbeiten und fand somit weitere klinische Verbreitung (Mikuni et al., 1960, 1965; Draeger, 1962; Hayatsu, 1964abc; Winter et al., 1971; Ulrich, 1976; Ulrich et al., 1977, 1985, 1987). Bis zum heutigen Tag wurde die Saugnapfokulopression in verschiedene diagnostische Verfahren integriert. Die Okulo-Oszillo-Dynamographie (OODG) ermöglicht die Bestimmung der retinalen und ziliaren Perfusionsdrucke. Der intraokulare Druck wird dabei auf suprasystolische Drucke erhöht und anschließend gleichmäßig wieder vermindert. Die Pulsationen im retinalen und choroidalen Gefäßbett werden über den Saugnapf als Volumenschwankungen zu einem Transducer geleitet und dort als Kurven dargestellt (Ulrich und Ulrich, 1985ab; Christ und Stodtmeister, 1987). Als eine Alternative zur Tonographie nach Leydecker (1956) wurde von Ulrich die Okulopressionstonometrie vorgestellt. Das Kammerwasser wird mittels Saugnapfokulopression ausgepreßt. Aus applanationstonometrischen Druckbestimmungen während und nach der Druckbelastungsphase kann der okuläre Abflußwiderstand ermittelt werden. Wie bei der OODG kann die Untersuchung an beiden Augen simultan durchgeführt werden (Ulrich et al., 1987). Ein weiterer Schritt in der Glaukomdiagnostik gelang mit der Entwicklung des Drucktoleranztests bzw. der Elektro-Encephalo-Dynamographie. Hierbei werden visuell evozierte Potentiale (VEP) unter stufenweise erhöhtem Augeninnendruck abgeleitet. Der Grad der Abnahme der VEP-Amplituden in Abhängigkeit vom intraokularen Druckzuwachs erlaubt eine Differenzierung zwischen Normalbefund, Niederdruckglaukom und anderen Glaukomformen. Diese Methode gibt Hinweise auf einen Autoregulationsmechanismus der Gefäße des Sehnervenkopfs (Ulrich et al., 1984, 1986; Pillunat et al., 1985, 1986ab; Stodtmeister et al., 1987). In der operativen Augenheilkunde kann die Saugnapfokulopression zur Augendrucksenkung vor intraokularen Eingriffen genutzt werden. Jedoch scheint diese Methode keine wesentlichen Vorteile gegenüber der Okulopression nach Vörösmarthy zu haben ( Hessemer et al., 1989 ). Zur angiographischen Untersuchung der retinalen und choroidalen Zirkulation bediente man sich sowohl des Bailliart'schen Prinzips ( Richard, 1985 ), als auch der Saugnapfokulopression ( Dollery, 1968; Blumenthal et al., 1970, 1971; Best et al., 1972; Ernest et al., 1972; Archer et al., 1972 ). Die Saugnapfokulopression erweist sich hier als die überlegenere Methode, da im Gegensatz zur Impressionsmethode keine Bulbusdislokation stattfindet und der Bulbus frei beweglich bleibt. Die photographische Aufnahme des Fundus ist somit jederzeit gewährleistet, während gleichzeitig durch Veränderung des negativen Drucks im Saugtrichter der intraokulare Druck beliebig variiert werden kann. Als Beispiel sei hier die retinale Fluorotachymetrie nach Schulte (1987) aufgeführt. Kurz vor Einstrom des Fluoreszeins an der Papille wird der intraokulare Druck abrupt auf suprasystolische Werte erhöht. Binnen 2 - 3 Sekunden erreicht die Farbstoffkonzentration im retrolaminaren Anteil der Zentralarterie ihr Maximum. Die rasche Beendigung der Druckerhöhung erzeugt eine äußerst scharfe Farbstofffront, welche eine exakte Bestimmung der retinalen Flußgeschwindigkeiten, selbst in den Kapillaren, zuläßt. Mit der zunehmenden Verbreitung der Saugnapfokulopression nach Kukán wurden auch verschiedene Geräte zur Erzeugung eines negativen Drucks im Saugnapf entwickelt. Die erste Apparatur von Kukán wurde bereits beschrieben. Von späteren Autoren wurden Modifikationen vorgestellt, welche keine wesentlichen Verbesserungen aufweisen ( Mikuni et al., 1960, 1965; Drance, 1962; Galin et al., 1969ab, 1970 ). Die modernen Apparaturen zur Saugnapfokulopression wie zum Beispiel der Okulo-Oszillo-Dynamograph ( OODG ) und der Okulopressionstonometer ( OPT ) generieren den negativen Druck mittels Membranpumpen, die durch Mikroprozessoren gesteuert werden ( Ulrich und Ulrich, 1985ab, 1987 ). Auch für die Saugtrichter wurden ständig neue Formen entwickelt und verschiedene Materialen erprobt (Abb. 2.) . Kukán entwarf zunächst metallene Saugnäpfe mit einem Durchmesser von 6 mm. Er erkannte jedoch rasch, daß eine Vergrößerung des Durchmessers auf 11 beziehungsweise 13 mm es ermöglicht, bei gleichem negativem Druck im Saugtrichter einen höheren intraokularen Druckzuwachs im menschlichen Auge zu erreichen (Kukán, 1931, 1936ab). |
|
Abb. 2 Sautrichter zur Okulopression |
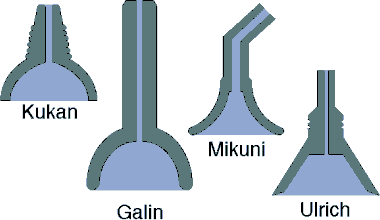
|
| . | Der Saugtrichter
nach Galin (1969ab) besaß prinzipiell die gleiche Form. Er ist aus
Kunststoff oder Aluminium gefertigt und hat einen Außendurchmesser
von 14 mm. Von Mikuni et al. (1960), Draeger und Beisker (1962) und Hayatsu (1964abc) wurden wiederum andere Saugtrichter benutzt. Sie sind mit den heute von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt für das Bundesgebiet zugelassenen Saugtrichtern vergleichbar. Letztere besitzen eine konische Trichterform mit einem der Bulbuskrümmung angepaßten Rand. Drei verschiedene Trichtergrößen (11, 12 und 13 mm) dieser aus Polioximethylen gefertigten Saugnäpfe stehen zur Auswahl (Ulrich und Ulrich, 1987). Auch die Beziehung zwischen negativem Druck im Saugtrichter und dem resultierenden intraokularen Druckzuwachs wurde von verschiedenen Autoren untersucht (Kukán 1936, Draeger, 1962; Hayatsu, 1964; Galin et al., 1970; Ernest et al., 1972). Für die heute von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt für die BRD zugelassenen Saugtricher wurden solche Untersuchungen von Ulrich und Ulrich (1987) und von Stodtmeister et al. (1989) durchgeführt. |
|
1.2. Die Entwicklung der Fluoreszenzangiographie |
Die Fluoreszenzangiographie
hat bereits in der Vergangenheit einen sehr wichtigen Beitrag zur Untersuchung
der physiologischen und pathologischen Hämodynamik des Auges geleistet.
Heute ist die Fluoreszenzangiographie ein wichtiges Routineverfahren zur Diagnostik
verschiedenartigster Erkrankungen von Netzhaut und Aderhaut.
Nach der erfolgreichen Synthese des Fluoreszeins im Jahre 1871 durch von Bayer, wurde dieser Farbstoff bereits 10 Jahre später in die Ophthalmologie eingeführt (Ehrlich, 1881). 1930 wurde erstmals im Tierversuch demonstriert, daß eine Darstellung der Fundusgefäße mit Fluoreszein möglich ist (Kikai, 1930). Trotzdem verging längere Zeit bis diese Erkenntnisse in ein klinisches Routineverfahren umgesetzt wurden.
1. Generation : Sequenzangiographie
2. Generation : Fluoreszenzkinematographie
3. Generation: Videoangiographie und digitale Bildverarbeitung
4. Generation : Scanning Laser Ophthalmoskopie
|
|
1.3. Fragestellung der eigenen Untersuchungen |
Die Fluoreszenzangiographie
unter abnehmendem Augeninnendruck (Fluorescence Angiography Under Decreasing
Ocular Pressure, FLADOP) wurde erstmals von Blumenthal und Best vorgestellt.
Dabei wird zunächst ein suprasystolischer Augeninnendruck mittels Saugnapfokulopression
erzeugt, so daß das Fluoreszein nicht in den Bulbus eintreten kann.
Wird dann der intraokulare Druck langsam wieder normalisiert, kommt es durch
den prolongierten Einstrom des Farbstoffes zu einer detaillierten Darstellung
der einzelnen Abschitte des retinalen und des choroidalen Gefäßnetzes
(Dollery, 1968; Blumenthal et al., 1970, 1971; Best et al., 1972).
Da diese Untersuchungen als Sequenzangiographien durchgeführt wurden, konnten bisher nur qualitative Auswertungen vorgenommen werden. Durch die hohe zeitliche Auflösung der Videoangiographie wird es erstmals möglich, die retinale und choroidale Perfusion bei erhöhten intraokularen Drucken sowohl qualitativ als auch quantitativ zu erfassen. Ziel dieser Arbeit ist es, die Anwendungsmöglichkeiten der Fluoreszenzangiographie unter künstlich erhöhtem Augeninnendruck zu untersuchen und die methodischen Ansätze zu verbessern, wobei folgenden Fragen nachgegangen wird :
|
|
|
|